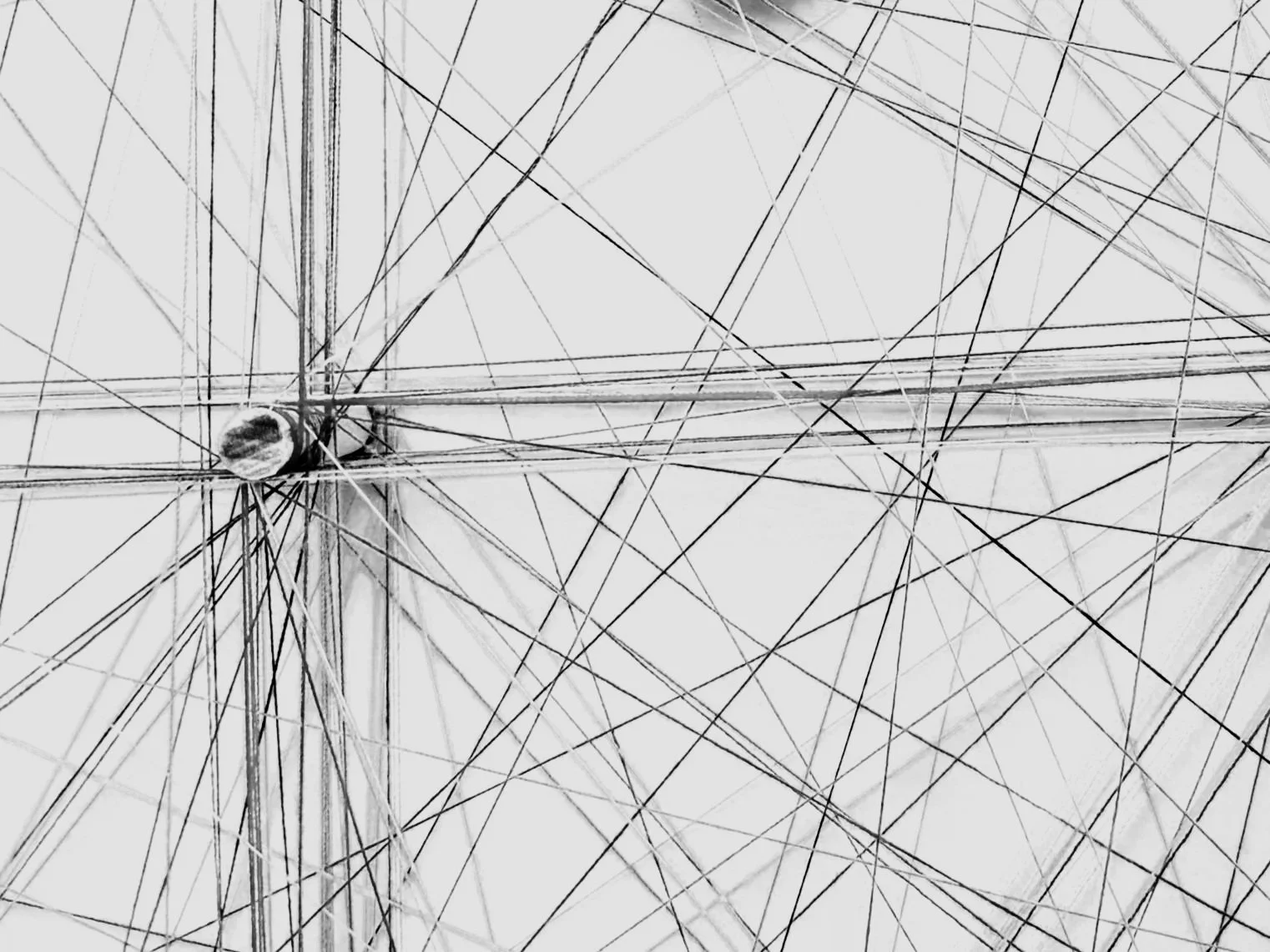Forschung
Ich habe die Praktische Philosophie bzw. Ethik als mein Forschungsfeld gewählt, weil sie mir die Möglichkeit gibt, grundlegende theoretische und normative Fragen zu bearbeiten, mit denen moderne Gesellschaften konfrontiert sind. Ethik bedeutet für mich, Klarheit in normativen Debatten zu schaffen – analytisch, kritisch, aber immer auch im Dialog: zwischen Disziplinen, zwischen Gesellschaft und Wissenschaft und zwischen Theorie und Praxis.
Medizin- und Bioethik
In meiner Forschung beschäftige ich mich mit ethischen Fragen in Medizin und Gesundheit, sowohl auf theoretischer als auch auf praktischer Ebene. Dabei arbeite ich interdisziplinär an den Schnittstellen von Philosophie, Medizin, Soziologie und feministischer Theorie, mit einem besonderen Fokus auf (Un)Gerechtigkeit.
In den letzten Jahren habe ich mich intensiv mit den ethischen Herausforderungen digitaler Entwicklungen innerhalb der Medizin und des Gesundheitswesens beschäftigt, zum Beispiel mit den ethischen Aspekten von Gesundheits-Apps. Insbesondere strukturelle und epistemische Ungerechtigkeit im Kontext KI-basierter Gesundheitsanwendungen beschäftigen mich seitdem in meiner Forschung.
Meine Forschung zu struktureller Ungerechtigkeit hat mir bewusst gemacht: Medizin- und Bioethik sollten stärker sozio-strukturelle Herausforderungen in den Blick nehmen. 2024 habe ich deshalb das interdisziplinäre Netzwerk Bioethik und strukturelle Ungerechtigkeit initiiert, um eine fachübergreifende Diskussion über strukturelle Ungerechtigkeit im Gesundheitsbereich zu fördern. Darüber hinaus leite ich die AEM-Arbeitsgruppe Feministische Perspektiven in der Medizin- und Bioethik (FME) und engagiere mich in der Redaktion der internationalen Buchreihe Emerald Studies in Critical Bioethics.
Neben meiner Forschung setze ich mich aktiv für die Weiterentwicklung der Medizinethik ein: Ich bin Vorstandsmitglied der Akademie für Ethik in der Medizin und Mitgründerin des Netzwerks Junge Medizinethik (JMED). Praktische Erfahrung habe ich in Ethikkomitees und -kommissionen gesammelt, z. B. an der Landesärztekammer Baden-Württemberg und der Universität Tübingen, und seit 2021 halte ich ein Zertifikat für Ethikberatung der Akademie für Ethik in der Medizin.
Meine Beiträge zur Bioethik wurden u. a. mit dem Caroline Miles Visiting Scholarship der Universität Oxford und dem Nachwuchspreis der Akademie für Ethik in der Medizin ausgezeichnet.
Technik- und Digitalethik
Ich forsche auch zu den ethischen Herausforderungen digitaler Technologien. Als Gastprofessorin für Philosophie und Ethik an der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg sowie in vorherigen Forschungsprojekten habe ich Autonomie, Vulnerabilität und Relationalität im Kontext von Self-Tracking-Apps, Vertrauen im Umgang mit digitalen Avataren sowie strukturelle und epistemische Ungerechtigkeit im Kontext sozialer Medien und KI-basierter Systeme untersucht. Durch diese Forschung bin ich mit aktuellen technologischen Entwicklungen und den dazugehörigen ethischen Ansätzen, wie etwa der Digitalethik, vertraut.
Besonders spannend finde ich das Verhältnis klassischer ethischer Theorien wie Deontologie oder Konsequentialismus und neu entwickelten Ansätzen. In jüngeren Veröffentlichungen habe ich gemeinsam mit Kolleg*innen erforscht, ob etwa die Tugendethik für KI-Systeme nützlich sein kann, welche Impulse feministische Ethiken für technologische Entwicklungen liefern und wie ethische Theorien für KI systematisch geordnet werden können.
Gemeinsam mit Kolleg*innen aus Medizin, Philosophie und Geschichte habe ich Methoden der Ethikforschung zu digitalen Technologien analysiert und einen Workshop zu digitalen Kompetenzen für Nachwuchsforschende organisiert. Seit 2024 bin ich im Leitungsteam der DGPhil-Arbeitsgruppe Philosophie der Digitalität. 2025 habe ich den Sammelband Applied Philosophy of AI (Wiley) mitherausgegeben und 2024 ein Special Issue bei Bioethics zu Digitalization, Health, and Aging.
Strukturelle Ungerechtigkeit
Strukturelle Ungerechtigkeiten prägen den Alltag unzähliger Menschen und haben tiefgreifende Folgen. Zugleich sind sie schwer zu fassen, da sie sich nicht auf individuelles Verhalten reduzieren lassen, sondern aus komplexen sozialen Prozessen hervorgehen. Beispiele hierfür sind ungleicher Zugang zur Gesundheitsversorgung, Ausschlüsse aus sozialen Medien oder die Unterrepräsentation marginalisierter Gruppen in der Forschung. Solche Phänomene sind weder zufällig noch Einzelfälle, sondern Ausdruck ungerechter sozio-struktureller Bedingungen.
In den vergangenen Jahrzehnten haben Debatten über strukturelle Ungerechtigkeit in der Philosophie und Ethik zunehmend an Bedeutung gewonnen. Trotz dieser Relevanz fehlt bislang jedoch ein einheitliches konzeptionelles Rahmenwerk für die normativ-ethische Analyse sozio-struktureller Phänomene. In meiner eigenen Forschung bin ich wiederholt auf strukturell bedingte Phänomene gestoßen, ohne adäquate ethische Werkzeuge zu ihrer Analyse vorzufinden. Dies möchte ich ändern: Mein aktuelles Forschungsprojekt zielt darauf ab, die bestehende Lücke zwischen der normativ-ethischen Diskussion sozio-struktureller Phänomene und dem bislang fehlenden systematischen Rahmen zu ihrer Analyse, zu schließen.
Feministische Philosophie und Ethik
Es ist mir ein Anliegen, feministische Theorie stärker in die ethische Forschung einzubringen. Meine bisherigen Projekte, etwa zu ethischen Aspekten im Bereich Gesundheit und den Implikationen technologischer Entwicklungen, haben mir gezeigt, dass feministische Ansätze international zunehmend Beachtung finden, in der deutschsprachigen Diskussion jedoch weniger präsent sind. Um diese Lücke zu schließen, habe ich 2021 die Arbeitsgruppe Feministische Perspektiven in der Medizin- und Bioethik (FME) gegründet. Ziel ist es, Dimensionen von (Gender-)Gerechtigkeit stärker in die ethische Forschung zu integrieren. Diese Initiative hat zu verschiedenen Veranstaltungen geführt, sowie zu der Veröffentlichung eines Special Issues zu zeitgenössischen feministischen Perspektiven in der deutschsprachigen Bioethik (ZEMO).
Unter feministischer Ethik verstehe ich die kritische Analyse von (Macht-)Strukturen, zum Beispiel in der Medizin, in digitalen Räumen und im Wissenschaftssystem selbst. Dabei geht es unter anderem um die Wahl epistemologischer Ressourcen, die Berücksichtigung marginalisierter Perspektiven, den Abbau von Partizipationsbarrieren, die Reflexion sozialer Auswirkungen von Forschung und Machtasymmetrien im Forschungsbetrieb.
In den letzten Jahren habe ich eine Vielzahl an Workshops und Kolloquien organisiert, etwa zu „Intersectional Justice“ oder „Diversity in Bioethics“, und mich didaktisch zu Diversität in hochschulischen Lehr- und Lernprozessen weitergebildet. Seit 2023 bin ich Frauen*-Beauftragte am Philosophischen Institut der Universität Bremen und SW*IP-Botschafterin für FLINTA in der Philosophie. Zuvor war ich Mitglied im Uterus-Transplantations-Board und im Differences of Sex Development Committee an der Universität Tübingen. Diese praktischen Erfahrungen ergänzen meine theoretische Forschung.
Mit meinen wissenschaftlichen Aktivitäten möchte ich Plattformen für interdisziplinären Austausch und Kooperation schaffen und so zu einer gerechteren Ethik beitragen.